|
Blattpflanzen
Blütenpflanzen
Fruchtpflanzen
Wurzelpflanzen
Arbeitskalender
Präparate
Heilpflanzen
Stichwortverzeichnis
Bücherliste
Links
Tabellen
Kontakt
Wortspielereien
| |
Der Januar im Überblick:
|
Allgemeines:
- Anbauplan aufstellen
- Keimproben durchführen
- Kalk streuen
- Kompost streuen
- Kompost umsetzen
- Umgraben
- Frühbeete bauen bzw. reparieren
- Mieten kontrollieren
- Saatgut bestellen
- Gartengeräte überprüfen
|
Aussaat
unter Glas:
|
Pflanzung:
Chicoree zum Treiben ansetzen
Schnittlauch zum Treiben eintopfen
Pflege & Pflanzenschutz
Schutzdecke auf überwinterndem Gemüse bei mildem Wetter lüften
Rhabarber mit Schutzdecke versehen
|
Ernte
- Chicoree
- Grünkohl
- Rosenkohl
- Schwarzwurzeln
- Meerrettich
- Petersilienwurzeln
- Sellerie
- Pastinaken
- Feldsalat
- Wirsing
- Porree
- Grünkohl
- Spinat
|
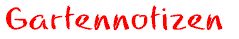

Leichte Gehölzvermehrung durch Stecklinge
 |
| Ligusterstecklinge, rechts steckfertig |
Stecklinge werden zwischen Dezember und Januar bei frostfreiem Wetter von
sommergrünen Ziersträuchern abgeschnitten. Verwendung finden nur letztjährige
Triebe. Sie werden locker gebündelt und bis zum Frühjahr in feuchtem Sand sehr
kühl, aber frostfrei aufbewahrt, entweder an schattiger Stelle im Freien, im
kalten Kasten oder im sehr kühlen Keller und ausreichend mit Sand oder Erde
bedeckt.
Folgende Gehölze lassen sich so leicht vermehren: Blasenspieren, Deutzie,
Hartriegel, Holunder, Liguster, Forsythie, Heckenkirsche, Pfeifenstrauch,
Kletterrose, Spiräe, Strauchrose, Tamariske, Wilder Wein, Zierjohannisbeere
u.a.
Ein Steckling sollte etwa sechs Augen haben. Die Triebe werden im Frühjahr auf
diese Länge geschnitten und kommen mit den unteren zwei Dritteln in Erde.
Praktisch und sicher ist es, wenn man sie einzeln in einen Spalt hinter das
Spatenblatt oder die Pflanzkelle steckt. Nachdem man das Gerät vorsichtig
herausgezogen hat, wird der Spalt zugetreten und beschattet.
Was ist jetzt zu tun ...
... im Gemüse- und Kräutergarten
Was soll wann wo gesät oder gepflanzt werden? Je gründlicher man dabei
vorgeht, desto besser.
Züchter bemühen sich, Sorten zu gewinnen, die gegen die wichtigsten
Krankheiten möglichst
widerstandsfähig sind oder wenigstens tolerant. Widerstandsfähige Sorten
werden nicht vom jeweiligen Erreger befallen, tolerante sind so ausgelegt, dass
sich der Befall in Grenzen hält und hingenommen, also toleriert werden kann.
Sobald der Anbauplan steht, rechnet man aus, wie viel Saatgut von jeder Gemüseart
oder -sorte gebraucht wird und bestellt oder besorgt bei guten Samenlieferanten.
Der Verzehr von frischem Gemüse ist im Winter besonders wichtig. Salatgemüse
gewinnt man mit der Treiberei von Chicorée und Löwenzahnwurzeln im Keller,
durch Treiberei von Kresse, Kerbel, Senf, Löffelkraut auf der Fensterbank. Auch
Keimsprosse verschiedenster Art tun das ihre, damit Wintermüdigkeit gar nicht
erst aufkommt. Der Einschlag im Frühbeet oder im Keller liefert noch Möhren,
Schwarzwurzeln, Rote Bete. Ein Einschlag im Freiland eventuell Grünkohl und
Porree.
Im Februar ist es noch früh im Jahr. Spätere Saaten holen früh getätigte oft
spielend wieder ein. Falls die Erde wirklich genügend abtrocknete, können Möhren,
Dicke Bohnen, Schwarzwurzeln, Zwiebeln, Spinat gesät werden. Man schützt sie
grundsätzlich mit Vlies oder Folie und sichert so ihren möglichst
reibungslosen Start.
Im warmen oder halbwarmen Frühbeet werden Radieschen, Spinat, Kresse,
Schnittsalat, Stielmus gesät oder kräftige Kopfsalatsetzlinge gepflanzt. Wer
dort Kohlrabi ziehen möchte, muss dafür sorgen, dass es im Beet nachts nicht kühler
wird als plus fünf Grad Celsius, weil sonst die Pflanzen leicht schießen. Ob
das Frühbeet zur Anzucht von Setzlingen verschiedener Gemüsearten dienen soll,
ist genau zu überlegen. Meist hat man mehr davon, dort die bereits genannten
Gemüsearten bis zur Erntereife zu kultivieren. Die wenigen nötigen Setzlinge fürs
Freiland kann man kaufen, wenn es so weit ist.
Rhabarber wird zwar in der Küche wie Obst behandelt, ist aber eine Gemüseart.
Er treibt von sich aus früh, doch kann man leicht nachhelfen und so besonders
früh besonders zarte Stiele ernten. Zu diesem Zweck den Boden rund um die
Pflanze mit Mist decken, über sie eine entsprechend große Kiste oder einen
Korb stülpen, darüber noch Folie breiten und kommen lassen. An warmen,
sonnigen Tagen lüften!
Was ist jetzt zu tun ...
... im Obstgarten
 |
Ältere Apfelbäume kann man im Winter auslichten
|
Beim Rückschnitt eines Triebes entsteht durch ein Schnittgesetz Längen-,
Dicken- und Seitenwachstum. Dieses aber wollen wir nicht an den Fruchtzweigen,
sondern nur an den Hauptleitästen. Da aber auch die eingekürzten Fruchtzweige
jetzt Holz (Neutriebe) statt wertvolle und gesunde Früchte produzieren, sieht
der Baum im Herbst aus wie ein Reiserbesen. Darüber hinaus wird das Innere der
Baumkrone zu dicht, sodass die Sonne nicht richtig einstrahlen kann. Dadurch
wird der Assimilationsprozess gestört und die vorhandenen Früchte können
nicht richtig ausreifen.
Ein weiterer Fehler ist ein falscher Kronenaufbau. Entweder sind am
Mittelleitast zu viele Seitenleitäste oder man lässt dem Mittelleitast die
dominierende Rolle, sodass er die Seitenleitäste beschattet. Die Folge ist,
dass sich an den Seitenleitästen nicht mehr genügend neue Fruchtzweige bilden
und anfangen, seitlich zu verkahlen.
Eine Baumkrone aber braucht Luft und Licht. Darum werden grundsätzlich nach
innen wachsende Triebe entfernt. Von Zweigen, die sich kreuzen oder reiben,
schneiden Sie einen weg. Achten Sie darauf, dass Sie immer dicht oberhalb eines
nach außen weisenden Auges die Schere ansetzen. Stellen Sie sich vor, wie der
Zweig an dieser Stelle aus der Blattknospe weiter wachsen wird. Auch alle
senkrecht hochwachsenden Triebe, so genannte Wasserschosse oder Geiltriebe, müssen
entfernt werden. Um nicht die falschen Triebe herauszuschneiden, müssen Sie die
verschiedenen Knospenformen der Obstbäume unterscheiden können. Die spitzen
Formen enthalten nur Blattaugen, die rundlichen umhüllen dagegen die Blüten-
und Fruchtaugen oder Knospen. Ein starker Rückschnitt fördert vor allem das
Holz-
wachstum. Ein behutsamer Schnitt, verbunden mit dem Herunterbinden bestimmter
Fruchtzweige, fördert die Fruchtansätze.
Obstbäume, deren Sorten nicht befriedigen, können zum Umveredeln vorbereitet
werden. Veredelungsreiser werden jetzt geschnitten und im kühlen Keller bzw. an
der Nordseite des Hauses eingeschlagen. Besser ist es, virusfreie
Veredelungsreiser zu kaufen (Baumschule).
Veredelungsreiser
von alten und seltenen Obstsorten können Sie beziehen von der Genbank
Obst Dresden-Pillnitz, Bergweg 23, 01326 Dresden, Telefon 0351/2615010
oder -11 sowie beim Pomologen Verein e.V., Brünlasberg 52, 08280 Aue,
Telefon: 03771/722493. |
Februar
Bei Obstbäumen in der abnehmenden Ertragsperiode und bei Streuobstbäumen kann
ein radikaler Verjüngungsschnitt oft Wunder wirken.
Der Verjüngungsschnitt wird auf drei Jahre verteilt. Im ersten Jahr wird der
Kronenaufbau überprüft. Alle Seitenleitäste, die zu viel sind, werden am
Mittelleitast weggeschnitten. Im zweiten Jahr werden die Seitenleitäste und der
Mittelleitast auf Saftwaagenhöhe auf waagerechte Fruchtzweige abgeleitet. Im
dritten Jahr werden alle Fruchtzweige, die zu alt, zu steil und zu viel oder zu
dicht sind, an der Basis der Hauptleitäste entfernt (weggeschnitten).
Pflanzenschutz
Jetzt können auch die Leimringe abgenommen werden. Um Rindenrisse zu vermeiden,
können an der Südseite der Baumstämme Bretter aufgestellt oder die Stämme
bis in die Hauptleitäste mit einem Bioanstrich aus dem Gartenfachgeschäft oder
selbst hergestellt (Lehmschlempe, Kalk, Kuhfladen) gestrichen oder gespritzt
werden.
Was ist jetzt zu tun ...

Freilandgemüse im Winter
Wir haben die Wahl
 |
|
Grünkohl schmeckt erst richtig nach dem ersten Frost, aber die
Endivie (oben) muss durch Abdecken geschützt werden.
|
Frisches Gemüse direkt aus dem Garten ist ernährungsphysiologisch besonders
wertvoll, auch im Winter. Was kann man im Dezember noch ernten? Zum Beispiel Möhren,
die durchaus bis Ende Dezember draußen bleiben können, vorausgesetzt man schützt
sie entsprechend. In klimatisch günstigen Gegenden, wo es selten vor Ende
Dezember richtig kalt wird, genügt es, das Beet mit einem Folientunnel zu überbauen.
Wo es schon mal stärker friert, deckt man das Beet handhoch mit Stroh oder
trockenem Laub und zusätzlich Zeitungspapier. Dann über alles Folie legen.
Zwischen Porreereihen schüttet man hoch Laub und stellt einen Folientunnel auf.
Handelt es sich nur um einige Porreestangen, nimmt man sie besser Anfang
Dezember aus der Erde und schlägt sie an einem windgeschützten, schattigen
Platz ein, und zwar tiefer, als sie zuvor standen, weil sonst die Stangen leicht
austrocknen und gelb werden. Laubschütte sorgt dafür, dass die Erde nicht
gefriert. Die Röschen von Rosenkohl halten zwar leichten Frost aus, doch stärkerer
Frost verdirbt sie schnell. Deswegen plant man Ernteschluss für Rosenkohl spätestens Weihnachten. Andernfalls empfiehlt es sich, die Pflanzen im Frühbeet
einzuschlagen, wo man sie gut vor stärkerem Frost schützen kann.
Grünkohl schmeckt bekanntlich erst richtig, nachdem Frost einen Teil der in ihm
enthaltenen Stärke in Zucker umwandelte und so die etwas bittere Komponente
vorteilhaft mildert. Bis Ende Dezember erntet man vom Beet, danach von Pflanzen,
die wie Rosenkohl im Frühbeet eingeschlagen werden.
Der größte Feind von Feldsalat ist Kahlfrost, wenn es ohne schützende
Schneedecke stärker friert. Fichtenzweige halten schädliche Sonne ab und
verhindern wiederholtes Gefrieren und Tauen in schnellem Wechsel. Zwischen die
Feldsalatreihen gibt man Rindenhumus, Kompost oder dergleichen, damit die
Pflanzen nicht auswintern. Eine Abdeckung mit Vlies ermöglicht es, selbst nach
Schneefall verhältnismäßig bequem an die Pflanzen heranzukommen und zu
ernten.
Meerrettich als Heilpflanze
Gesundheit wächst im Garten
Die R-Monate von September bis April sind traditionsgemäß die Monate des
Meerrettichs. Dann haben die Wurzeln das meiste Aroma. Jeder kennt ihren
scharfen Geschmack, wenn sie Fleisch- und Fischgerichte würzen. Sie heizen
einem richtiggehend ein.
Aber Meerrettich ist mehr als nur Würzpflanze. Seit antibiotische Inhaltsstoffe
entdeckt wurden, steigt seine Bedeutung als Heilpflanze. Außerdem enthalten die
Wurzeln ätherische Öle, etwa Senfölglykosid, Rhodanwasserstoff, Asparagin,
Arginin sowie beachtlich viel Vitamin C. Früher wusste man aus Erfahrung, dass
Meerrettich verdauungsfördernd wirkt, heute etwas genauer, dass die Wirkstoffe
Niere und ableitenden Harnwegen gut tun. Auch zur Linderung von Bronchitis und
hartnäckigem Husten kann Meerrettich dienen. Dazu wird fein geriebener
Meerettich mit der gleichen Menge Zucker oder Honig vermischt und davon zwei-
bis dreimal täglich ein Teelöffel genommen. Bei Blasen-und Niereninfektionen
handelt man ebenso. Mit Umschlägen aus Wurzelbrei auf der Haut bei Zahn- und
Kopfschmerzen, Rheuma und Asthma muss man vorsichtig sein und nicht länger als
fünf bis zehn Minuten einwirken lassen, weil der scharfe Saft die Haut
andernfalls zu sehr strapaziert.
Der Anbau von Meerettich im Garten ist also aus guten Gründen ratsam.
Allerdings können manche Anweisungen zur Kultur manchen davon abbringen, denn
sie wird als höchst umständlich beschrieben. Dabei ist sie im Grunde ganz
einfach, weil Meerrettich für den Eigenbedarf praktisch von selbst wächst. Im
Garten kommt es nicht darauf an, lange, gerade, dicke Stangen zu ernten, sondern
zu passender Zeit Wurzelstücke, egal welchen Formats zur Hand zu haben. Ein
Wurzelableger reicht für den Anfang. Den pflanzt man im Früjahr oder Herbst in
lockeren, tiefgründigen, stets genügend feuchten Boden, entfernt während des
Sommers blühende Triebe und deckt im Herbst sowie Frühjahr eine gute Lage
Kompost über die Pflanzen, die sich ohne Zutun vermehren. Vor Beginn stärkerer
Fröste nimmt man einige Wurzeln aus der Erde und hebt sie im Sandeinschlag auf.
Meerrettich gehört zu den Kreuzblütlern, hat bis 100 Zentimeter lange,
ziemlich breite Blätter und weiße Blütchen in rispenartigen Blütenständen
im Juni und Juli. Da sich gewöhnlich keine Samen bilden, wird Meerrettich
ausschließlich vegetativ mit Hilfe der Wurzeln vermehrt. Die Pflanze stammt aus
Südeuropa sowie Westasien und wird bereits seit dem 12. Jahrhundert europaweit
kultiviert. Die Bezeichnung Meerrettich ist eine Verballhornung des Namens Mährrettich
gleich Pferderettich. Mit Meer hat Meerrettich nichts zu tun. In Süddeutschland
heißt Meerrettich Kren.
Was sind schlafende Augen?
 |
| Schlafendes Auge im Ast |
Fachausdrücke versteht man mitunter nicht auf Anhieb. Aber was soll man sich
unter Augen vorstellen, die ein Gehölz haben soll? Dazu noch schlafende Augen?
Augen sind in der Gärtner-Fachsprache allgemein Knospen, aus denen sich alles Mögliche
entwickeln kann: Triebe, Blätter, Blüten. Schlafende Augen, also ruhende
Knospen, sind nicht voll ausgebildet, sondern befinden sich sozusagen im
Embryostadium. Soweit kennt sich mittlerweile jeder mit Genforschung aus, um zu
wissen, dass sich auch aus frühem menschlichem embryonalem Gewebe ein vollständiger
Körper mit den unterschiedlichsten Organen entwickeln kann. Schlafende Augen
erwachen erst nach starken Reizen aus dem Ruhezustand. Jene von Gehölzen werden
zu Seitenknospen und damit zur Ausgangsbasis von Seitensprossen.
Schlafende Augen finden sich am unteren Ende der Triebe, jeweils im Übergang zu
älterem Holz. Dort ist der Trieb meist gestaucht mit mehreren Rindenringen.
Schnittmaßnahmen in diesem Bereich üben starke Reize aus. Sie fördern gezielt
den Austrieb von schlafenden Augen zum Zwecke der Verjüngung, zur
Kronenkorrektur etc. Derart angelegter Schnitt dicht über dem so genannten
Astring heißt Rückschnitt auf schlafende Augen. Rückschnitt auf Astring
entfernt dagegen den gesamten Trieb einschließlich schlafender Augen, sodass an
dieser Stelle kein Austrieb mehr erfolgt.
 |
| Auch im Kleingewächshaus kann man sich im Spätwinter das erste Gemüse
ziehen |
Was ist jetzt zu tun ...
im Gemüse- und Kräutergarten
Während man draußen beim Gemüse kaum etwas zu besorgen hat außer
eventuellem Zurechtrücken des Winterschutzes bei Feldsalat, Spinat,
Wintersteckzwiebeln und dergleichen, geht es im Haus zur Sache mit der Treiberei
von Chicorée, Löwenzahnwurzeln, Petersilienwurzeln, Schnittlauch, Kresse,
Senf, Keimsprossen, damit auch im Winter frisches Gemüse zur Verfügung steht.
Im Februar wird nun an Hand des Bestellungsplanes für das Gemüseland Saatgut
besorgt. Wo es besonders früh Frühling wird und die Erde genügend
abtrocknete, kann man bereits Melde, Spinat, Schnittsalat säen. Im Frühbeet
geht es unabhängig von der Witterung los mit Saat von Schnittsalat, Radieschen,
Kresse, Stielmus. Vorher ist eventuell die verbrauchte Erde im Beet gegen
frische auszuwechseln. Dann legt man gleich Fenster auf, damit sich die Erde,
aufgeheizt durch die Sonne, genügend erwärmt. Eine Mistpackung macht das Beet
besonders warm. Darüber kommt mindestens 20 Zentimeter gute, humose,
wildkrautfreie Erde. Am unteren Kastenrand soll der Abstand zum Glas 25
Zentimeter betragen, am oberen entsprechend mehr. Beginn der Rhabarbertreiberei
ab Ende des Monats.
 |
| Zwei gleiche Obstarten sollte man nicht an der selben Stelle
hintereinander pflanzen, da sonst Bodenmüdigkeit auftritt |
Was ist jetzt zu tun ...
im Obstgarten
Der Obstbaumschnitt kann im Januar bei günstigem Wetter fortgesetzt werden.
Der Schnitt der Obstbäume gehört zu den schwierigsten obstbaulichen Arbeiten.
Er ist bei allen Obstarten notwendig und beeinflusst wie die übrigen Pflegemaßnahmen,
z.B. Düngung und Pflanzenschutz, die Ertragsleistung.
Der »Naturgemäße Obstbaumschnitt« ist eine »Kunst«, die Fachwissen und
Einfühlungsvermögen vorraussetzt. »Erst denken, dann handeln« (abschneiden)
heißt die Devise.
Deshalb kann ich allen Obstgärtnern nur raten, zunächst einmal bei einem
Fachmann in die praktische Lehre zu gehen. Sehen sie einmal eine Zeit lang einem
geübten Obstbaumgärtner beim Schneiden zu. Oder besuchen Sie einen Fachkursus,
der von einem Kleingartenverein oder einem Obst- und Gartenbauverein
veranstaltet wird. Des weiteren bieten auch die Volkshochschulen solche Lehrgänge
an. Siehe hierzu das Buch »Naturgemäßer Obstbaumschnitt«. Auch
der Schnitt des Beerenobstes (ausgenommen Brombeeren, diese werden besser erst
im März geschnitten) kann - sofern er nicht sofort nach der Ernte erfolgte -
durchgeführt werden.
Bodenmüdigkeit
Dem Phänomen der so genannten Bodenmüdigkeit glauben Wissenschaftler der
Biologischen Bundesanstalt (BBA) auf die Spur gekommen zu sein. Ursache sei eine
besondere Gruppe von Bakterien, die die Pflanze im Wurzelbereich schädigt. Die
Bodenmüdigkeit tritt vor allem bei Pflanzen aus der Familie der Rosengewächse
(Rosaceae) auf und ist ein lange bekanntes Problem im Obstbau, in Baumschulen
und auch bei Ziergehölzen. Betroffene Pflanzen weisen einen verminderten Wuchs
und eine abnehmende Anzahl von Früchten auf. Die Bodenmüdigkeit tritt schon
nach einmaligem Nachbau derselben Pflanzenart auf, z.B. wenn eine Fläche mit
Apfelbäumen gerodet und auf der selben Fläche wieder Apfelbäume gepflanzt
werden. Im Nachbau leiden dann nur jene Pflanzen unter der Bodenmüdigkeit, die
mit der vorher angebauten Pflanzenart eng verwandt sind.
Bei langwierigen Versuchen an Apfelbäumen fanden die Wissenschaftler der BBA
aus Dresden-Pillnitz Bakterien aus der Gruppe der Actinomyceten. Diese Bakterien
zerstören einen ganz bestimmten Wurzeltyp, die Faserwurzeln. Über sie nimmt
die Pflanze Wasser und Nährstoffe auf. Wie Untersuchungen an Apfelbäumen
ergaben, befallen die Bakterien die Faserwurzeln während der Frühjahr- und
Sommermonate, also dann, wenn die Bäume den höchsten Nährstoffbedarf haben.
Deshalb merke: Steinobst nach Kernobst und Kernobst nach Steinobst.
Düngung
Unsere Obstbäume und Beerensträucher brauchen neben Wasser, Luft, Licht und Wärme
für ihr Wachstum verschiedene Nährstoffe. Nur durch eine Bodenuntersuchung können
wir feststellen, welche Dünger oder Spurenelemente unserem Boden fehlen.
Pflanzenschutz
Jetzt können die Leimringe abgenommen werden. Um Rindenrisse zu vermeiden, können
an der Südseite der Baumstämme Bretter aufgestellt oder die Stämme bis in die
Hauptleitäste mit einem Bioanstrich (z.B. Preicobakt) gestrichen oder gespritzt
werden.
 |
| Weißkohl, die Hauptzutat für Sauerkraut |
Was ist jetzt zu tun ...
in der Hauswirtschaft und Gesundheitsvorsorge
Es war ein gutes Kohljahr vielerorts, und so mancher Gartenbesitzer hat
sicher eine reiche Ernte wohl gerundeter Köpfe einbringen können. Eine gute
Alternative zur normalen Lagerung wäre da die Bereitung eigenen
Sauerkrautes.
Damit hätten wir nicht nur das Lagerproblem gelöst, sondern auch ein wohl
schmeckendes und ernährungsphysiologisch wertvolles Nahrungsmittel erhalten.
Sauerkraut besitzt reichlich Vitamine, neben einem hohen Vitamin C-Gehalt auch
weitere, wie Vitamin A und B, dazu wichtige Mineralien, wie z.B. Kalzium und
Kalium, gesundheitsfördernde Ballaststoffe und, besonders hervorzuheben, die
Milchsäure.
Im Darm wirkt sie entzündungshemmend und fäulniswidrig, im Magen entfaltet sie
eine ähnliche Wirkung wie die Magensäure und unterstützt so die Verdauung.
Sie ist ebenfalls in der Lage, erkrankte Gewebsteile zu zerstören ohne das
gesunde Gewebe anzugreifen. So ist der Gebrauch frischen, rohen Sauerkrautes als
Auflage bei Verbrennungen, Verletzungen und hitzigen Geschwüren, wie es früher
auf dem Lande oftmals üblich war, durchaus berechtigt.
Vorrangig dient Sauerkraut jedoch der Ernährung, wenngleich es auch hier ganz
gezielt für gesundheitliche Belange eingesetzt werden kann. Wer unter
chronischer Verstopfung leidet, könnte z.B. vor jeder Mahlzeit ein Schälchen
Sauerkraut genießen, selbstverständlich roh und sorgfältig gekaut. Zudem kann
rohes Sauerkraut bei Blähsucht und infektiösen Magen- und Darmerkrankungen äußerst
hilfreich sein, wie auch bei allen so genannten Erkältungskrankheiten
(besonders durch seinen hohen Vitamin C-Gehalt). Zubereitet mit etwas kalt
gepresstem Pflanzenöl und gemischt mit den unterschiedlichsten Obstarten wie Äpfel,
Birnen, Weintrauben, Ananas oder Orangen lässt sich Sauerkraut als Appetit
anregende Vorspeise oder leichte Mahlzeit zwischendurch servieren. Zusammen mit
Kartoffeln in ihren verschiedensten Zubereitungsformen lassen sich mit
Sauerkraut sättigende Hauptgerichte zubereiten. Frischkost-Salate aus
feingeschnittenem Kohl, sei es nun Wirsing, Weiß- oder Rotkohl wird durch eine
Zugabe von rohem Sauerkraut nicht nur schmackhafter sondern auch leichter
verdaulich.
Die Herstellung des Sauerkrautes ist denkbar einfach. Das geputzte Kraut wird
ohne Strunk entweder mit dem Handhobel oder einer entsprechenden Küchenmaschine
fein geschnitten und mit Salz vermischt (15 Gramm auf fünf Kilogramm Kraut).
Dazu kommen Gewürze und Beigaben nach Geschmack, wie Kümmel, Dill oder
Fenchelsamen, Apfelstückchen, einige Knoblauchzehen oder kleine weiße
Zwiebelchen und Wacholderbeeren. Alles wird sorgfältig gemischt und so lange
mit der Hand oder einem geeigneten Gegenstand gestampft, bis der austretende
Saft das Kraut überdeckt. Abgefüllt wird entweder in spezielle Gärtöpfe, die
eine saubere, problemlose Gärung durch die integrierte Wasserrinne garantieren
oder bei kleineren Mengen in Gläser mit den so genannten Twist-Off-Verschlüssen.
Über dem Füllgut sollte genügend Platz für den Gärungsprozess gelassen
werden. Etwa zehn Tage sollte das Gefäß bei plus 18 bis 22 Grad Celsius
stehen, danach wird es in einem kühlen Raum aufbewahrt. Nach etwa sechs Wochen
kann man mit dem Verzehr beginnen. Im Kühlschrank hält sich Sauerkraut etwa
eine Woche frisch, soviel sollte auch jedes Mal dem Topf entnommen werden, um
ihn nicht zu oft öffnen zu müssen. Sehr wichtig ist dabei peinliche
Sauberkeit. Zudem sollte man darauf achten, dass ständig etwas Saft über dem
Kraut steht; Steine zum Beschweren sind den Töpfen meist beigelegt, ein
entsprechender Teller tut aber die gleichen Dienste. Sauerkraut im Topf hält
sich über viele Monate lang frisch, für kleine Mengen hat sich das Einsäuern
in Gläsern bestens bewährt.
|